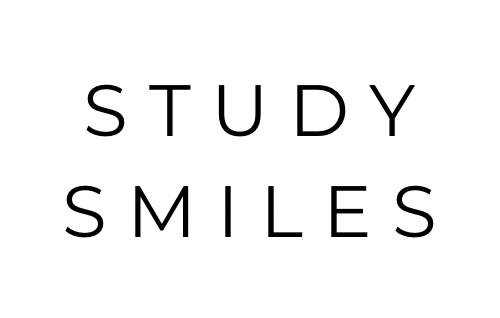Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Ziel: Erwerb umfassender theoretischer Kenntnisse und praktischer Fähigkeiten zur Erkennung, Verhütung und Behandlung von Zahnfehlstellungen und Kieferanomalien (Dysgnathien) bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Dauer & Struktur (Basis: MWBO & aktuelle WBOs der Länder)
- Regel-Gesamtdauer: Vier Jahre nach der Approbation.
- Aufteilung (bundesweit konsistent nach aktuellen WBOs):
- Mindestens ein Jahr allgemeinzahnärztliche Tätigkeit (das „Allgemeinzahnärztliche Jahr“), i.d.R. Voraussetzung für Beginn der Fachweiterbildung.
- Mindestens drei Jahre fachspezifische Weiterbildung in Kieferorthopädie, davon:
- Mindestens ein Jahr an einer Universitäts-Zahnklinik (Poliklinik für Kieferorthopädie) – **dies ist obligatorisch und kann nicht vollständig durch Praxiszeit ersetzt werden.**
- Bis zu zwei Jahre in einer zur Weiterbildung ermächtigten kieferorthopädischen Praxis.
- Vollzeit: Die Weiterbildung erfolgt hauptberuflich und in Vollzeit.
- Teilzeit: Teilzeitregelungen sind meist möglich (Antrag bei LZK, Bedingungen prüfen).
- Weiterbildungsstätten: Die Kombination aus Universitätsklinik und ermächtigter Praxis ist der Standardweg. Die LZKs führen Listen der zugelassenen Stätten. Die Plätze, insbesondere an den Universitäten, sind oft sehr begehrt.
Inhalte (gemäß MWBO/WBO)
Die Weiterbildung vermittelt umfassende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in folgenden Bereichen (Beispiele, Details im Katalog der jeweiligen WBO):
- Grundlagen: Embryologie, pränatale und postnatale Entwicklung des Schädels, des Gesichtes und des Kausystems; Anatomie und Histologie des Kopf- und Gesichtsbereichs; relevante Genetik und Humangenetik; Physiologie und Pathophysiologie des Kauorgans; Myologie und Neurophysiologie im orofazialen System.
- Diagnostik:
- Systematische Anamneseerhebung (allgemeinmedizinisch, spezifisch kieferorthopädisch).
- Klinische Befunderhebung: Extraorale und intraorale Untersuchung, Gesichtsanalyse, Profilanalyse, manuelle und instrumentelle Funktionsanalyse (bei CMD-Verdacht).
- Modellerstellung und -analyse: Konventionelle Gipsmodelle und digitale Modelle (Scans), Indexauswertungen (z.B. TPI, PAR-Index).
- Fotografie: Standardisierte extra- und intraorale Fotodokumentation und -analyse.
- Röntgendiagnostik: Indikationsstellung, Anfertigung und Auswertung von OPG, Fernröntgenseitenbild (FRS), Handröntgenbild (zur Wachstumsbestimmung), ggf. Einzelzahnaufnahmen und DVT.
- Kephalometrie: Durchführung und Interpretation verschiedener FRS-Analysen (z.B. nach Steiner, Ricketts, Tweed, Hasund) zur Beurteilung skelettaler und dentaler Strukturen.
- Ätiologie: Verständnis der Ursachen von Zahn- und Kieferfehlstellungen (genetische Faktoren, skelettale Wachstumsstörungen, funktionelle Störungen wie Habits oder Dysfunktionen, Einflüsse von Zahnzahl- oder -größenanomalien).
- Therapieplanung: Umfassende Analyse der diagnostischen Unterlagen; Erstellung individueller Behandlungspläne unter Berücksichtigung von Alter, Wachstum, Art der Anomalie, Patientenwünschen und interdisziplinären Aspekten; Risikobewertung; Aufklärung und Einverständniserklärung.
- Therapeutische Verfahren & Apparaturen:
- Prävention und Frühbehandlung: Interzeptive Maßnahmen, Lückenhalter, Behandlung von Habits.
- Herausnehmbare Apparaturen: Aktive Platten zur dentalen Bewegung, funktionskieferorthopädische Geräte (FKO) zur Wachstumssteuerung (z.B. Bionator, Aktivator, Fränkel-Funktionsregler).
- Festsitzende Apparaturen (Multibracket-/Multibandtechnik): Indikationen, verschiedene Bracketsysteme (Metall, Keramik, selbstligierend), Bogensequenzen, Verankerungskonzepte (Headgear, TPA, Lingualbogen, skelettale Verankerung mittels Mini-Implantaten/Pins).
- Alignertherapie: Indikationen, Grenzen, digitale Planung (ClinCheck o.ä.), Behandlungsdurchführung und -überwachung.
- Extraktionstherapie vs. Non-Extraktionstherapie: Indikationen und Planung.
- Distalisierungs- und Mesialisierungsmechaniken.
- Management von verlagerten und retinierten Zähnen (chirurgisch-kieferorthopädische Einstellung).
- Behandlung von Erwachsenen (ggf. mit parodontalen Vorschäden, prothetischem Bedarf).
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit:
- Kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlungen bei ausgeprägten Dysgnathien (prä- und postchirurgische KFO).
- Kieferorthopädie bei Parodontalpatienten (Abstimmung mit Parodontologen).
- Präprothetische Kieferorthopädie zur Optimierung der Ausgangslage für Zahnersatz.
- Behandlung von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und anderen kraniofazialen Anomalien im Team.
- Zusammenarbeit mit Logopäden bei funktionellen Störungen.
- Retention: Notwendigkeit, Planung und Durchführung der Retentionsphase zur Stabilisierung des Behandlungsergebnisses (herausnehmbare Retentionsgeräte, festsitzende Retainer).
- Materialkunde: Eigenschaften und Biokompatibilität kieferorthopädischer Materialien (Drähte, Brackets, Kunststoffe, Kleber).
- Praxismanagement & Abrechnung: Spezifische Aspekte der KFO-Praxisorganisation, Qualitätsmanagement, Abrechnung nach BEMA (KIG) und GOZ/GOÄ.
- Wissenschaftliches Arbeiten: Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Fachliteratur und Studien.
Bürokratie & Ablauf
(Approbation, Nachweis Allgemeinjahr, Stellensuche Uni & Praxis, Anmeldung LZK, Logbuch, Zeugnisse, Prüfungsantrag) – Wie zuvor beschrieben, Koordination von Uni- und Praxisplatz erforderlich und oft herausfordernd.
Prüfung
Fachliches Gespräch (ca. 45-60 Min.) vor Prüfungsausschuss der LZK über das gesamte Gebiet. Bei Bestehen: Urkunde „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“.
Unterschiede nach Bundesland (Stand: April 2025 – Prüfung der lokalen WBO unerlässlich!)
Die Struktur (1+3 Jahre, 1 Jahr Uni Pflicht) ist bundesweit Standard. Details können variieren.
- Baden-Württemberg (LZK BW): Quelle: LZK BW – Weiterbildung
- Bayern (BLZK): Quelle: BLZK – Weiterbildungsordnung
- Berlin (ZÄK Berlin): Quelle: ZÄK Berlin – Weiterbildungsordnung
- Brandenburg (LZKB): Quelle: LZKB – Weiterbildungsordnung
- Bremen (ZÄK HB): Quelle: ZÄK HB – Weiterbildungsordnung
- Hamburg (ZÄK HH): Quelle: ZÄK HH – Weiterbildung
- Hessen (LZKH): Quelle: LZKH – Weiterbildungsordnung
- Mecklenburg-Vorpommern (ZÄK MV): Quelle: ZÄK MV – Weiterbildungsordnung
- Niedersachsen (ZKN): Quelle: ZKN – Weiterbildungsordnung
- Nordrhein (ZÄK Nordrhein): Quelle: ZÄK Nordrhein – Weiterbildungsordnung
- Rheinland-Pfalz (LZK RLP): Quelle: LZK RLP – Weiterbildungsordnung
- Saarland (ZÄK Saarland): Quelle: ZÄK Saarland – Weiterbildung
- Sachsen (LZK Sachsen): Quelle: LZK Sachsen – Weiterbildungsordnung
- Sachsen-Anhalt (ZÄK SA): Quelle: ZÄK SA – Weiterbildungsordnung
- Schleswig-Holstein (ZÄK SH): Quelle: ZÄK SH – Weiterbildungsordnung
- Thüringen (LZK Thüringen): Quelle: LZK Thüringen – Weiterbildungsordnung
- Westfalen-Lippe (ZÄK WL): Quelle: ZÄK WL – Weiterbildungsordnung
Referenz MWBO: BZÄK – Weiterbildung.
=> Fazit Bundesland-Unterschiede KFO: Auch hier hohe Übereinstimmung mit dem 1+3 Modell inkl. Pflicht-Uni-Jahr. Immer die lokale WBO konsultieren!
Finanzielle Aspekte (Vertieft)
Einkommen während der Weiterbildung (4 Jahre):
- Status: Angestellte/r Weiterbildungsassistent/in.
- Vergütung im Universitätsjahr: I.d.R. nach TV-Ärzte TdL (Entgeltgruppe Ä1, steigend). Transparent & geregelt. (Ressource: oeffentlicher-dienst.info – TV Ärzte).
- Vergütung in der Praxiszeit (bis zu 2 Jahre): Stärker Verhandlungssache. Kann am Klinikgehalt orientiert sein oder abweichen, abhängig von Praxisstruktur (GKV/PKV-Anteil), Region, Erfahrung.
- Allgemein: Solides Angestelltengehalt, aber deutlich unter dem späteren Potenzial als Fachzahnarzt.
Einkommenspotenzial nach der Weiterbildung (als Fachzahnarzt für Kieferorthopädie):
- Als Angestellte/r: Gehalt meist deutlich über Weiterbildungsniveau, oft Grundgehalt + leistungs-/umsatzbezogene Anteile. Attraktive Verdienstmöglichkeiten.
- Als Niedergelassene/r: Generell sehr hohes Einkommenspotenzial, zählt oft zu den Top-Verdienern unter Zahnärzten. ABER: Stark abhängig von Management, Standort, Konkurrenz, Balance GKV (KIG) / PKV & Selbstzahler (Aligner etc.). Hohes Risiko & Investitionsbedarf.
Fazit Finanzen: Exzellente Einkommensperspektiven nach der Weiterbildung, insbesondere bei erfolgreicher Niederlassung. Wirtschaftliche Führung erfordert Verständnis für KIG/GOZ/GOÄ. Während der Weiterbildung liegt Fokus auf Kompetenzerwerb.
Alternativen & Abgrenzung zur formalen Weiterbildung (Erweiterte Darstellung)
Diese Wege führen nicht zur Gebietsbezeichnung „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“ und können die formale Weiterbildung nach WBO nicht ersetzen.
- Curricula (Strukturierte Fortbildungsserien):
- Konzept: Modulare Reihen (ca. 100-250+ Std.) mit Zertifikat. Vermitteln Wissen und Techniken in Teilbereichen oder als Überblick.
- Anbieter & Beispiele (Auswahl, keine qualitative Bewertung oder Vollständigkeit):
- Umfassende Curricula KFO: LZK-Akademien/Institute (ZFZ Stuttgart, Pfaff Berlin, KHI NRW, ZANIS NDS, Karlsruhe etc.), APW, Haranni Academie, private Institute (z.B. Prof. Hinz).
- Spezifische Curricula: Alignertherapie (DGAO – dgao.com, Hersteller-Kurse), Lingualtechnik, CMD/Funktionstherapie, Kinder-KFO, Digitale KFO.
- Status: Zertifikat, Kompetenzerwerb, oft Basis für TSP. Kein Fachzahnarzt.
- Masterstudiengänge (z.B. Master of Science – M.Sc.):
- Konzept: Berufsbegleitende, universitäre/hochschulische Studiengänge (4-6 Semester), akademischer Grad M.Sc., kostenintensiv, oft international.
- Anbieter & Beispiele (Auswahl, Stand prüfen):
- Danube Private University (DPU) Krems (DPU M.Sc. KFO)
- Hochschule Fresenius / IFG (IFG M.Sc. KFO)
- Universität Greifswald (ggf. Angebote prüfen)
- IMC FH Krems (ggf. Angebote prüfen)
- Weitere internationale Universitäten.
- Status: Akademischer Grad M.Sc. Signalisiert wissenschaftliche Vertiefung. Keine Fachzahnarztqualifikation nach deutscher WBO! Kann nicht das Pflicht-Uni-Jahr der Weiterbildung ersetzen.
- Tätigkeitsschwerpunkt (TSP) Kieferorthopädie:
- Konzept: Ausweisung einer Fokussierung nach LZK-Richtlinien.
- Voraussetzungen: Regeln der lokalen LZK prüfen (oft Curriculum KFO + Fallzahlen + Erfahrung).
- Status: Signal für Fokus. Kein Fachzahnarzt-Titel. Stellt geringere Anforderungen als die Fachzahnarzt-Weiterbildung.
Erneuter wichtiger Hinweis zur Abgrenzung und Klarstellung: Der Titel „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“ ist die höchste formale, staatlich geregelte Qualifikation in Deutschland, basierend auf einer 4-jährigen, strukturierten Weiterbildung (inkl. Pflicht-Uni-Jahr) und Prüfung. Qualifikationen wie Zertifikate aus Curricula, der akademische Grad M.Sc. oder der Tätigkeitsschwerpunkt (TSP) sind **davon klar zu unterscheiden** und ersetzen die formale Fachzahnarzt-Weiterbildung nicht und können auch keine Teile davon (wie das Uni-Jahr) ersetzen.