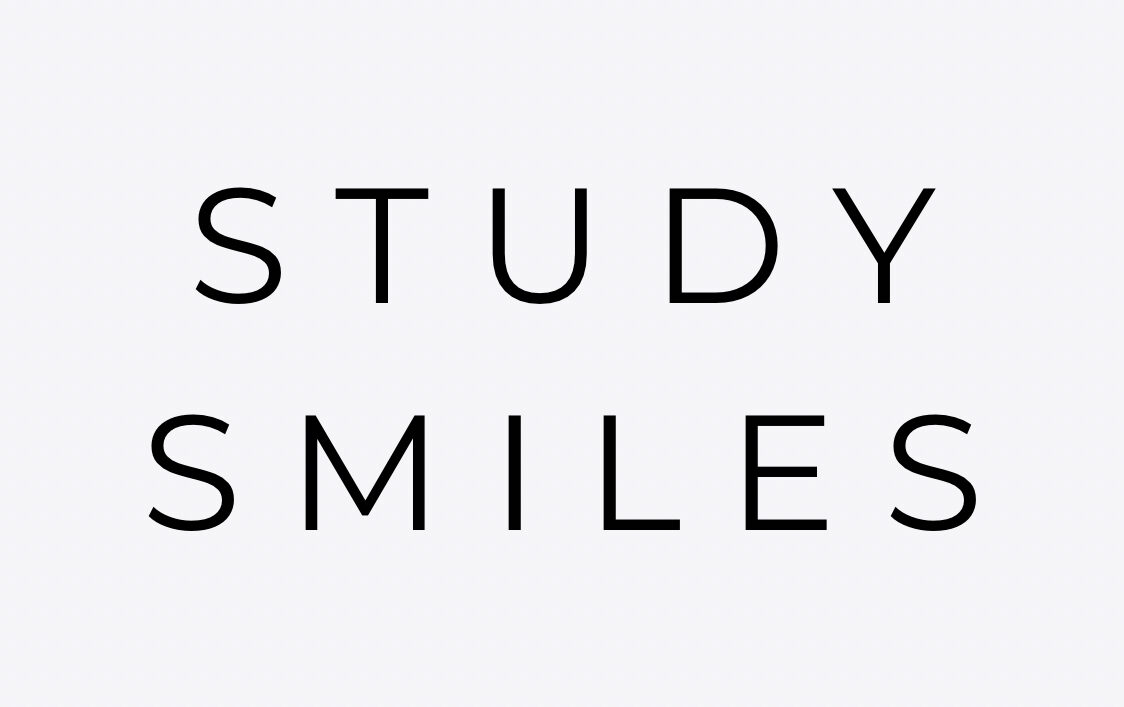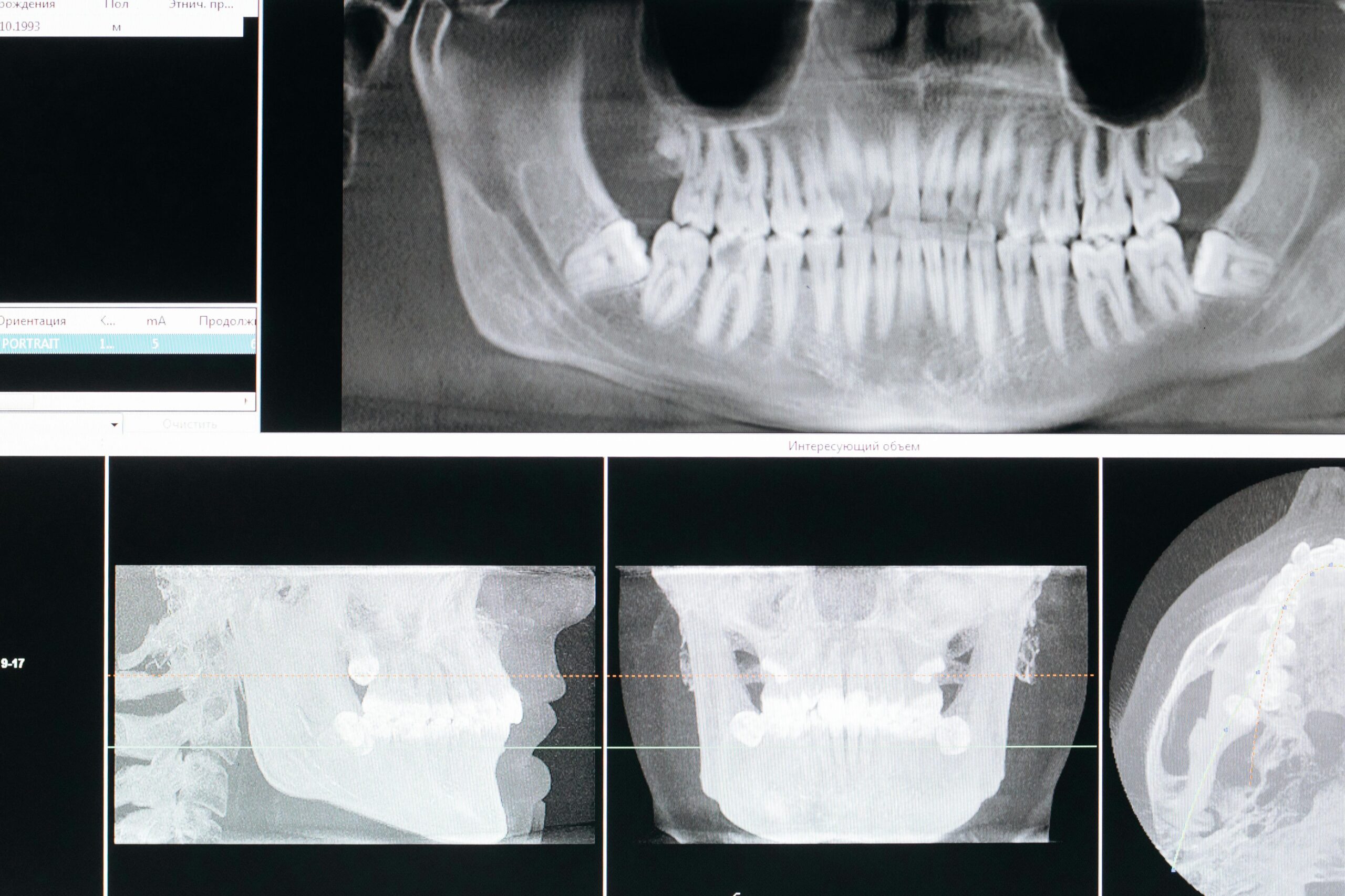Leitlinien im Fokus: Übergreifende Themen – Halitosis, Risikopatienten & Notfälle
Neben den großen Fachdisziplinen gibt es eine Reihe von Themen, die alle Bereiche der Zahnmedizin betreffen oder spezielle Patientengruppen und Situationen in den Fokus rücken. Auch hierfür bieten Leitlinien wertvolle Orientierung, um systematisch und evidenzbasiert vorzugehen.
Denken Sie daran: Für Details und aktuelle Versionen immer das AWMF-Register (www.awmf.org) prüfen!
Diagnostik und Therapie der Halitosis (Mundgeruch)
Kernaussagen:
- Ursachen: Die überwiegende Mehrheit der Halitosis-Fälle (ca. 85-90%) hat ihre Ursache innerhalb der Mundhöhle! Hauptverursacher sind bakterielle Zersetzungsprozesse auf dem Zungenrücken (Zungenbelag!) und in tiefen Zahnfleischtaschen (Parodontitis). Auch Karies, undichte Füllungen, mangelnde Mund- oder Prothesenhygiene und Mundtrockenheit spielen eine Rolle. Extraorale Ursachen (HNO-Bereich, Magen-Darm, Lunge, systemische Erkrankungen, Medikamente) sind deutlich seltener.
- Diagnostik:
- Anamnese: Wann tritt der Geruch auf? Wie stark? Selbst- oder Fremdwahrnehmung? Ernährungsgewohnheiten? Mundhygiene? Systemische Erkrankungen/Medikamente?
- Klinische Untersuchung: Inspektion der Mundhöhle, Beurteilung von Zungenbelag (Quantität, Lokalisation), parodontaler Status (Taschentiefen, BOP!), Kariesdiagnostik, Prüfung von Zahnersatz.
- Organoleptische Prüfung: Direkte Beurteilung des Atems durch den Untersucher (objektivste Methode, erfordert aber Erfahrung/Standardisierung).
- Zusatztests (seltener nötig): Messung flüchtiger Schwefelverbindungen (VSC) mit speziellen Geräten (Halimeter).
- Bei V.a. extraorale Ursache: Überweisung an entsprechenden Facharzt (HNO, Internist etc.).
- Therapie (bei intraoraler Ursache):
- Kausale Therapie: Beseitigung der Ursache!
- Zungenreinigung: Die mechanische Reinigung des Zungenrückens (mit Zungenschaber oder -bürste) ist oft die wichtigste Einzelmaßnahme!
- Mundhygiene optimieren: Instruktion zu Zähneputzen und Interdentalreinigung.
- Behandlung von Parodontitis und Karies.
- Professionelle Zahnreinigung.
- Ggf. Anpassung/Reinigung von Zahnersatz.
- Unterstützende Maßnahmen: Kurzzeitig können antiseptische Mundspülungen (z.B. CHX, Zink-haltige Lösungen) helfen, die Bakterienlast zu reduzieren, ersetzen aber nicht die mechanische Reinigung!
- Kausale Therapie: Beseitigung der Ursache!
Zahnärztliche Behandlung von Patienten mit seltenen Erkrankungen / besonderen Bedürfnissen
Kernaussagen:
- Herausforderung: Für seltene Erkrankungen gibt es naturgemäß wenige spezifische Leitlinien. Die Behandlung erfordert oft eine individuelle Recherche und eine hohe Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
- Informationsquellen: Nutzen Sie Datenbanken für seltene Erkrankungen (z.B. Orphanet), Informationen von Selbsthilfegruppen, spezialisierten Behandlungszentren und vor allem den direkten Kontakt zu den behandelnden Fachärzten des Patienten!
- Grundprinzipien:
- Umfassende Anamnese: Genaue Erfassung der Grunderkrankung, Medikation, spezifischer Risiken (z.B. Blutungsneigung, Infektanfälligkeit, eingeschränkte Kooperation).
- Interdisziplinäre Kommunikation: Rücksprache mit den behandelnden Ärzten ist oft unerlässlich, um das individuelle Risiko abzuschätzen und das zahnärztliche Vorgehen abzustimmen.
- Risikoabwägung: Jede zahnärztliche Maßnahme muss sorgfältig gegen die Risiken der Grunderkrankung abgewogen werden.
- Anpassung der Behandlung: Ggf. sind spezielle Vorsichtsmaßnahmen nötig (Antibiotikaprophylaxe, Sedierung/Narkose, Behandlung unter stationären Bedingungen).
- Kommunikation: Besonders einfühlsame Kommunikation mit Patienten und ggf. Betreuern/Angehörigen ist wichtig.
Management von dentalen Notfällen in der Praxis
Kernaussagen:
- Vorbereitung ist alles! Jede Praxis muss auf die häufigsten medizinischen Notfälle vorbereitet sein.
- QM-Elemente (siehe QM-Leitfaden):
- Schriftlicher Notfallplan mit klaren Aufgabenverteilungen.
- Griffbereite, regelmäßig überprüfte Notfallausrüstung (Notfallkoffer/-wagen, Sauerstoff, ggf. AED).
- Regelmäßiges praktisches Notfalltraining des gesamten Teams (mind. jährlich!).
- Handlungsschemata: Leitlinien (oft aus der Notfallmedizin/Anästhesie, z.B. vom German Resuscitation Council – GRC) geben klare Handlungsempfehlungen für spezifische Notfälle nach dem ABCDE-Schema (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).
- Häufige Notfälle & Kernmaßnahmen:
- Synkope: Flachlagerung, Beine hoch, Vitalzeichenkontrolle.
- Hyperventilation: Beruhigen, ruhige Atmung anleiten.
- Hypoglykämie: Schnelle Zuckerzufuhr (oral, wenn ansprechbar), Notarzt bei Bewusstlosigkeit.
- Anaphylaxie: Sofort Adrenalin i.m. (Autoinjektor!), Notarzt, Antihistaminikum/Kortison, O2.
- Angina Pectoris/Herzinfarkt: Oberkörper hoch, Ruhe, O2, Nitro (wenn Patient es hat), ASS, sofort Notarzt!
- Krampfanfall: Schutz vor Verletzung, stabile Seitenlage nach Anfall, Notarzt bei prolongiertem/wiederholtem Anfall.
- Aspiration: Husten lassen, ggf. Heimlich-Manöver (Erwachsene), Notarzt bei Atemnot.
- Dokumentation: Jeder Notfall muss detailliert dokumentiert werden!
Antibiotika-Einsatz & Risikopatientenmanagement (Querverweis & Vertiefung)
Kernaussagen:
- Antibiotika: Der Einsatz sollte immer einer strengen Indikationsstellung folgen, um Nebenwirkungen und insbesondere die Resistenzentwicklung zu minimieren!
- Therapeutisch: Bei klarer bakterieller Infektion mit Ausbreitungstendenz oder Systemzeichen.
- Prophylaktisch: Nur bei gesicherten Indikationen (Endokarditisrisiko-Hochgruppen, schwere Immunsuppression etc.). Leitlinien helfen bei der Auswahl des geeigneten Mittels, der Dosierung und Dauer. Keine routinemäßige Prophylaxe bei einfachen Eingriffen!
- Risikopatientenmanagement:
- Anamnese ist entscheidend: Genaue Erfassung aller relevanten Allgemeinerkrankungen und Medikamente.
- Leitlinien nutzen: Für häufige Risikokonstellationen (Antikoagulation, Antiresorptiva/MRONJ, Bestrahlung/ORN, Diabetes, Endokarditisrisiko etc.) gibt es spezifische Leitlinien oder Empfehlungen, die das Vorgehen beschreiben (siehe auch Chirurgie-Artikel).
- Interdisziplinäre Absprache: Bei Unsicherheiten oder komplexen Fällen ist die Rücksprache mit dem behandelnden Haus- oder Facharzt unerlässlich für eine sichere Behandlung!
Fazit
Auch für übergreifende Themen wie Halitosis-Management, den Umgang mit besonderen Patientengruppen oder die Vorbereitung auf Notfälle bieten Leitlinien wertvolle Hilfestellungen. Sie betonen oft die Bedeutung einer systematischen Diagnostik, einer individualisierten Therapie und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Der rationale Einsatz von Antibiotika und ein fundiertes Risikomanagement sind ebenfalls zentrale Aspekte leitliniengerechten Handelns.