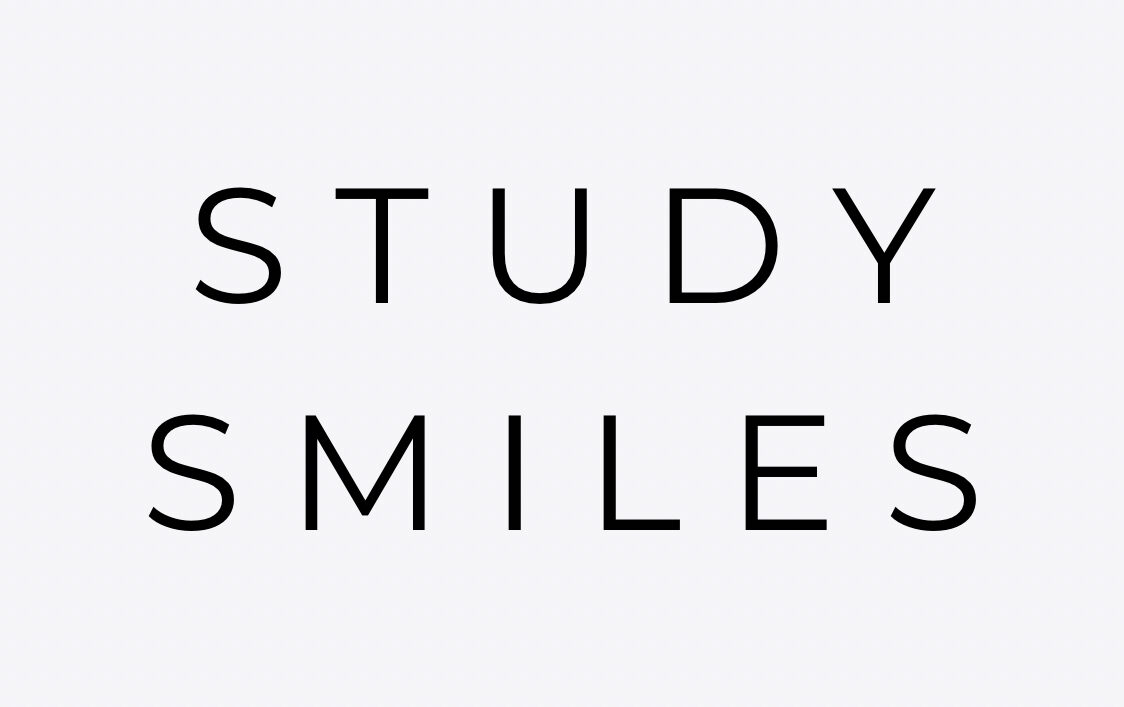Finanzen, Kalkulation & Abrechnung
Die wirtschaftliche Führung einer Zahnarztpraxis erfordert ein tiefes Verständnis der eigenen Zahlenwelt. Viele Praxisinhaber fokussieren sich auf den Umsatz, vernachlässigen jedoch die Kostenseite und die Liquiditätsplanung. Dieser Beitrag beleuchtet die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die Berechnung von Honoraren im privatärztlichen Bereich und die Mechanismen der vertragszahnärztlichen Abrechnung.
1. Differenzierte Kostenanalyse
Eine einfache Einteilung in “Ausgaben” reicht für eine strategische Steuerung nicht aus. Kosten müssen nach ihrem Verhalten bei Beschäftigungsschwankungen und ihrer steuerlichen Relevanz unterschieden werden.
| Kostenart | Detail-Erklärung & Relevanz |
| Fixkosten (Gemeinkosten) | Kosten, die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft zwingend anfallen – auch bei Null Umsatz. Beispiele: Personal (inkl. Lohnnebenkosten), Raumkosten, Versicherungen, Leasingraten, Software-Pflege, Beiträge (Kammer/KZV), Abschreibungen. Ziel: Diese Kosten müssen durch den Mindestumsatz gedeckt sein (Break-Even). |
| Variable Kosten (Einzelkosten) | Kosten, die direkt einer Behandlung zugeordnet werden können. Beispiele: Füllungsmaterialien, Implantate, Einmalinstrumente, Prophylaxe-Artikel, Fremdlabor (Durchlaufposten). Steuerung: Hier lohnt sich aktives Bestandsmanagement und Einkaufspolitik. |
| Kalkulatorische Kosten | Ausgaben, die in der BWA oft fehlen, aber eingepreist werden müssen. Beispiel: Kalkulatorischer Unternehmerlohn (Was würde ein angestellter Zahnarzt für deine Arbeit kosten?), kalkulatorische Miete (bei eigener Immobilie). |
2. Der Praxisstundensatz: Die Währung deiner Zeit
Um wirtschaftlich zu arbeiten, muss bekannt sein, was eine Behandlungsstunde kostet. Dies ist die Basis für die betriebswirtschaftliche Begründung von Faktorsteigerungen (§ 2 Abs. 1 GOZ).
- Schritt 1: Ermittlung der GesamtkostenSumme aller Fixkosten + kalkulatorischer Unternehmerlohn + gewünschter Gewinnaufschlag.
- Schritt 2: Ermittlung der produktiven StundenEin Jahr hat ca. 2.080 Arbeitsstunden (bei 40h/Woche). Davon abzuziehen sind:
- Urlaub (ca. 30 Tage)
- Feiertage (ca. 10 Tage)
- Krankheit (kalkulatorisch ca. 5-10 Tage)
- Fortbildung
- Verwaltungszeit (Zeit am Schreibtisch ist keine Zeit am Stuhl! Realistisch: 10-15%)
- Ergebnis: Oft verbleiben nur ca. 1.300 bis 1.500 produktive Stunden am Behandlungsstuhl.
- Schritt 3: Berechnung des Minutenkostensatzes$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Produktive Stunden} \times 60} = \text{Kosten pro Minute}$Beispiel: Ein Minutenkostensatz von 3,50 € – 5,00 € ist in modernen Praxen keine Seltenheit. Jede Behandlung, die darunter liegt, verzehrt Substanz.
3. Controlling mit der BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)
Die BWA vom Steuerberater ist das monatliche Cockpit. Sie muss jedoch interpretiert werden, da sie steuerrechtlich und nicht liquiditätsorientiert aufgebaut ist.
Wichtige Kennzahlen (Key Performance Indicators – KPIs):
- Personalkostenquote: (Personalaufwand / Gesamtumsatz) $\times$ 100.
- Benchmark: 25 % – 32 %. Steigt sie darüber, ist entweder der Umsatz zu schwach oder die Struktur ineffizient.
- Materialkostenquote: (Materialaufwand / Gesamtumsatz).
- Benchmark: 5 % – 8 % (ohne Fremdlabor). Höhere Werte deuten auf Verschwendung oder schlechte Einkaufskonditionen hin.
- Fremdlaborquote: Sollte sich neutral verhalten, da Fremdlaborleistungen 1:1 weiterberechnet werden. Abweichungen deuten auf nicht abgerechnete Laborleistungen hin.
Wichtig: Die BWA zeigt den vorläufigen Gewinn, nicht den Kontostand. Tilgungen für Kredite mindern den Gewinn in der BWA nicht, fließen aber vom Konto ab!
4. Der Abrechnungszyklus der KZV
Die Abrechnung gegenüber der Kasse ist ein Massenverfahren mit strengen Spielregeln. Ein Fehler im Prozess kann die Liquidität eines ganzen Quartals gefährden.
- Dateneinreichung & Prüfung:Zum Quartalsende (meist ca. 10 Tage danach) werden die Abrechnungsdaten (KCH, KFO, PAR, KB) elektronisch übermittelt. Die KZV prüft zunächst nur formal-rechnerisch (z.B. unzulässige Positionskombinationen).
- Zahlungsfluss (Liquiditätsfalle):Die KZV zahlt monatliche Abschläge. Die tatsächliche Restzahlung für Q1 erfolgt oft erst im Juli oder August.
- Gefahr: Sind die Abschläge zu hoch angesetzt (z.B. weil das Vorjahr umsatzstark war), drohen bei der Endabrechnung Rückforderungen statt Nachzahlungen. Rücklagen sind hier essenziell.
- Wirtschaftlichkeitsprüfung (Auffälligkeitsprüfung):
- Mechanismus: Deine Abrechnungsstatistiken (Fallwerte, Häufigkeit von Positionen wie BEMA 12, Ä1 etc.) werden mit dem Durchschnitt der Fachgruppe im KZV-Bezirk verglichen.
- Grenzwert: Ab einer Überschreitung von ca. 40-50 % (je nach KZV) wird eine Prüfung eingeleitet.
- Folge: Du musst beweisen, dass die Mehraufwände medizinisch notwendig waren (Praxisbesonderheit). Gelingt dies nicht, wird das Honorar gekürzt (Regress). Eine präzise Dokumentation (“erschwerte Trepanation”, “übermäßige Blutung”) ist der einzige Schutz.