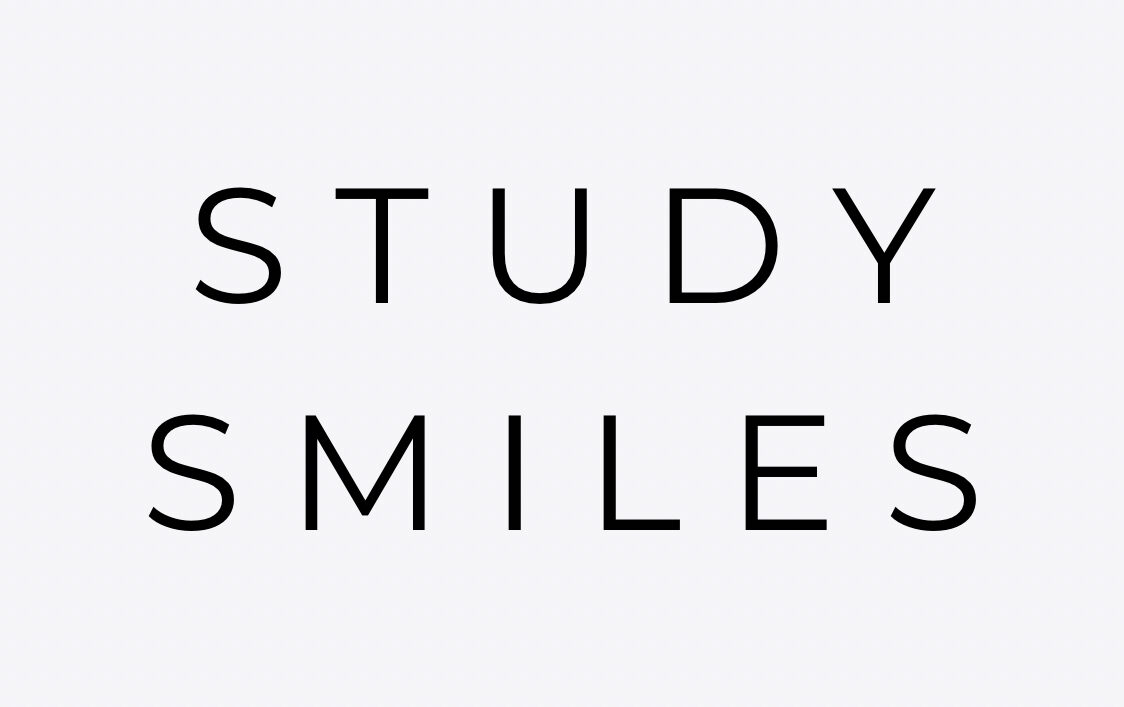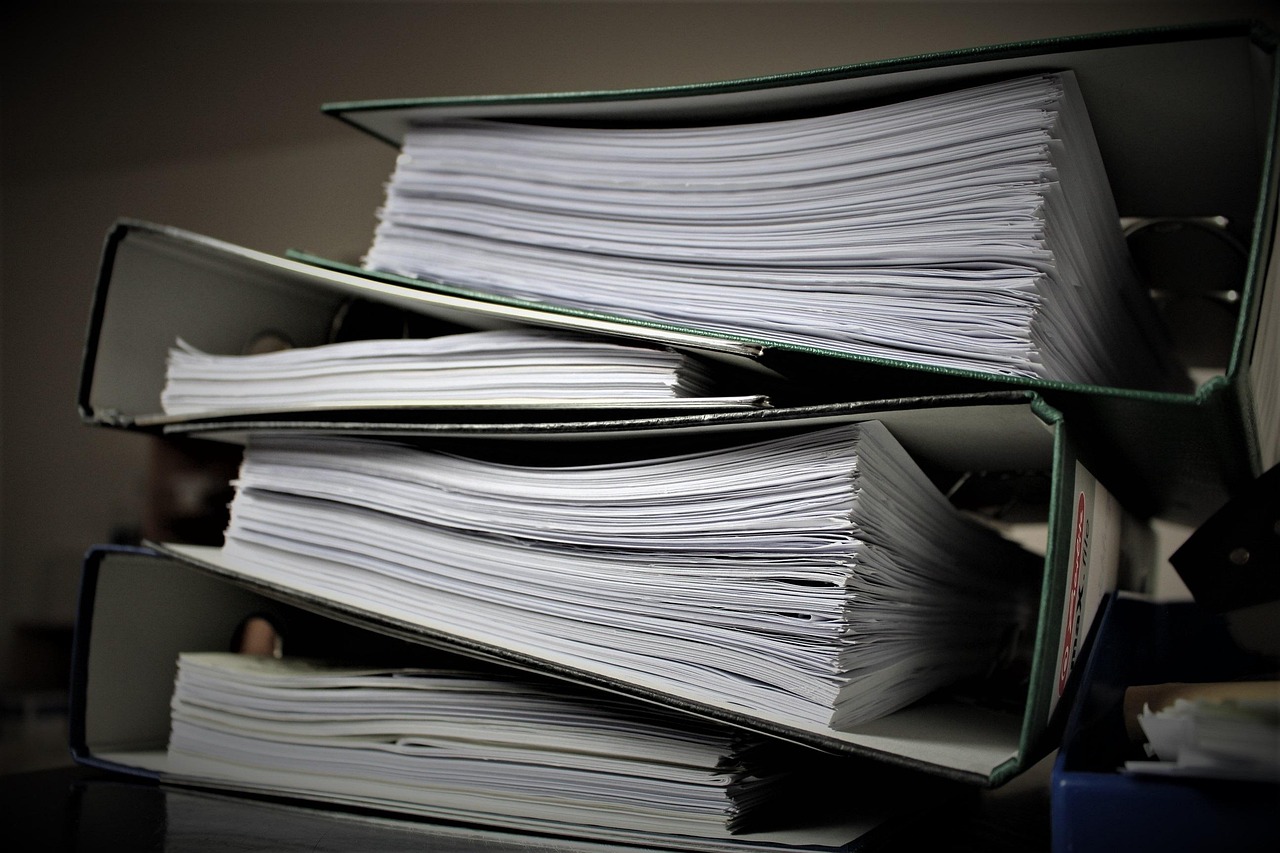Rechte und Pflichten im Behandlungszimmer – Der Vertrag zwischen Zahnarzt und Patient

Leitfaden: Das Zahnarzt-Patienten-Verhältnis – Rechtliche Grundlagen
Im ersten Artikel haben wir die Bedeutung rechtlicher Kenntnisse im Praxisalltag beleuchtet. Nun konzentrieren wir uns auf das Kernstück der rechtlichen Beziehung: das Verhältnis zwischen Ihnen als Zahnärztin oder Zahnarzt und Ihren Patienten. Dieses basiert nicht nur auf Vertrauen, sondern wird durch klare gesetzliche Regelungen geformt. Maßgeblich sind hier vor allem das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit den Paragraphen zum Behandlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB), das Berufsrecht der Zahnärztekammern sowie relevante Aspekte des Strafrechts (insbesondere Schweigepflicht, Körperverletzung bei fehlender Einwilligung).
Der Behandlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB): Die rechtliche Grundlage
Der Behandlungsvertrag ist die Basis der rechtlichen Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Patienten. Er kommt in der Regel zustande, sobald ein Patient Ihre Praxis aufsucht und Sie mit einer Untersuchung oder Behandlung beginnen – dies geschieht oft mündlich oder sogar stillschweigend (konkludent), z.B. durch das Beginnen des Anamnesegesprächs oder die Untersuchung.
Aus diesem Vertrag ergeben sich gegenseitige Rechte und Pflichten:
Ihre Hauptpflichten als Behandler/in:
- Behandlung nach Fachzahnarztstandard (“lege artis”): Sie sind verpflichtet, die Behandlung nach den zum Zeitpunkt der Behandlung anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem bewährten zahnärztlichen Erfahrungsstand durchzuführen. Wichtig ist: Sie schulden in der Regel keinen bestimmten Erfolg (wie die lebenslange Haltbarkeit einer Füllung), sondern das fachgerechte Bemühen um diesen Erfolg (Dienstvertrag nach § 611 BGB, konkretisiert durch §§ 630a ff. BGB).
- Sorgfaltspflicht: Bei allen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen müssen Sie die gebotene zahnärztliche Sorgfalt walten lassen.
- Aufklärungs- und Informationspflichten: Eine umfassende Aufklärung des Patienten ist unerlässlich (siehe nächster Abschnitt).
- Dokumentationspflicht: Alle relevanten Schritte müssen sorgfältig dokumentiert werden (siehe Abschnitt zur Dokumentation).
- Schweigepflicht: Über alle patientenbezogenen Informationen ist Stillschweigen zu bewahren (siehe Abschnitt zur Schweigepflicht).
Hauptpflichten des Patienten:
- Mitwirkungspflicht: Der Patient ist angehalten, bei der Anamnese wahrheitsgemäße Angaben zu machen, medizinische Anweisungen zu befolgen und vereinbarte Termine einzuhalten oder rechtzeitig abzusagen.
- Vergütungspflicht: Bei Privatleistungen (nach GOZ) oder gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungen ist der Patient zur Begleichung des Honorars verpflichtet.
Grenzen der Behandlungspflicht:
- Privatpatienten: Hier gilt grundsätzlich Vertragsfreiheit. Vor Zustandekommen eines Behandlungsvertrags können Sie die Behandlung eines Privatpatienten ablehnen (außer in Notfällen), ohne Gründe angeben zu müssen.
- GKV-Patienten (Gesetzliche Krankenversicherung): Aufgrund des Sicherstellungsauftrags der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) besteht hier ein Kontrahierungszwang. Das bedeutet, Sie müssen GKV-Patienten grundsätzlich behandeln. Eine Ablehnung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (z.B. Überlastung der Praxis, fehlende Spezialisierung, gestörtes Vertrauensverhältnis, Nichtbefolgen ärztlicher Anweisungen). Details hierzu finden sich im Vertragszahnarztrecht.
- Beendigung des Behandlungsverhältnisses: Ein bestehendes Behandlungsverhältnis kann grundsätzlich von beiden Seiten gekündigt werden. Als Zahnarzt dürfen Sie die Behandlung jedoch nicht “zur Unzeit” kündigen, also nicht in einer Phase, in der dem Patienten dadurch gesundheitliche Nachteile entstehen könnten. Eine Kündigung durch den Zahnarzt während einer laufenden Behandlung ist meist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. nachhaltig zerstörtes Vertrauensverhältnis, wiederholte massive Pflichtverletzung durch den Patienten) möglich und erfordert, dass Sie dem Patienten Gelegenheit geben, sich anderweitig in Behandlung zu begeben.
Die Aufklärungspflicht (§ 630e BGB): Unverzichtbar für die Einwilligung
Die ärztliche Aufklärung ist eine Ihrer zentralen Pflichten und die Voraussetzung für eine rechtswirksame Einwilligung des Patienten. Nur ein Patient, der Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Großen und Ganzen verstanden hat, kann wirksam zustimmen.
Worüber müssen Sie aufklären? (Umfang)
- Diagnose: Verständliche Erklärung der Erkrankung oder des Befundes.
- Geplante Therapie: Detaillierte Information über Art, Umfang und Ablauf der vorgeschlagenen Behandlung.
- Behandlungsalternativen: Darstellung aller medizinisch sinnvollen und gleichwertigen Alternativen (sofern vorhanden), einschließlich ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile. Auch das Abwarten oder Nichtstun kann eine relevante Option sein, über deren Konsequenzen aufgeklärt werden muss.
- Risiken und Komplikationen: Umfassende Aufklärung über typische, mit dem Eingriff verbundene Risiken (“Regelfallrisiken”) sowie über seltene, aber für die Lebensführung des Patienten schwerwiegende Risiken, sofern diese spezifisch mit dem Eingriff verbunden sind und die Entscheidung des Patienten beeinflussen könnten. Eine ehrliche Darstellung ohne Beschönigung ist geboten.
- Prognose: Einschätzung der Erfolgsaussichten der geplanten Therapie im Vergleich zu den Alternativen.
- Wirtschaftliche Aspekte: Insbesondere bei Privatleistungen oder Selbstzahlerleistungen muss über die voraussichtlichen Behandlungskosten aufgeklärt werden (ggf. durch Heil- und Kostenplan).
Zeitpunkt und Form der Aufklärung:
- Rechtzeitig: Die Aufklärung muss so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient ausreichend Zeit hat, die Informationen zu verarbeiten, Fragen zu stellen und eine überlegte Entscheidung zu treffen. Eine Aufklärung unmittelbar vor dem Eingriff (“auf dem Behandlungsstuhl”) ist bei planbaren Maßnahmen in der Regel nicht ausreichend!
- Verständlich: Die Aufklärung muss in einer für den Patienten verständlichen Sprache erfolgen. Vermeiden Sie reinen Fachjargon oder erklären Sie ihn. Visuelle Hilfsmittel (Bilder, Modelle) können unterstützend wirken.
- Mündlich im persönlichen Gespräch: Das Gesetz schreibt das persönliche Gespräch vor. Schriftliche Aufklärungsbögen können und sollen dieses Gespräch unterstützen, vorbereiten und dokumentieren, sie ersetzen es jedoch nicht! Geben Sie dem Patienten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Folgen fehlender oder fehlerhafter Aufklärung:
- Die darauf basierende Einwilligung des Patienten ist rechtlich unwirksam.
- Die durchgeführte Behandlung – selbst wenn sie medizinisch korrekt (lege artis) war – stellt dann rechtlich eine eigenmächtige Heilbehandlung und damit eine Körperverletzung dar.
- Dies kann zu zivilrechtlichen Ansprüchen auf Schadensersatz und Schmerzensgeld führen, selbst wenn kein Behandlungsfehler vorliegt!
Die Einwilligung (§ 630d BGB): Das informierte “Ja” des Patienten
Jeder ärztliche Eingriff, der die körperliche oder gesundheitliche Integrität des Patienten berührt, bedarf seiner vorherigen Einwilligung. Diese Einwilligung legalisiert den Eingriff.
Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung:
- Aufklärung (“Informed Consent”): Der Patient muss, wie oben beschrieben, korrekt und umfassend aufgeklärt worden sein.
- Freiwilligkeit: Die Entscheidung muss ohne Zwang, Täuschung oder unzulässige Beeinflussung getroffen werden.
- Einwilligungsfähigkeit: Der Patient muss nach seiner geistigen und sittlichen Reife fähig sein, die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs zu erkennen und seinen Willen danach zu bestimmen. Dies ist bei Erwachsenen in der Regel anzunehmen, kann aber bei bestimmten Erkrankungen (z.B. fortgeschrittene Demenz) oder Zuständen (z.B. starke Schmerzen, Medikamenteneinfluss) eingeschränkt sein. Eine Diagnose allein begründet aber noch keine Einwilligungsunfähigkeit!
- Einwilligung bei Minderjährigen:
- Grundsätzlich ist die Einwilligung beider sorgeberechtigter Elternteile erforderlich.
- Bei einfachen, risikoarmen Behandlungen kann ggf. die Einwilligung eines Elternteils ausreichen (wenn vom Einverständnis des anderen auszugehen ist).
- Bei bereits einsichtsfähigen Jugendlichen (die Grenze ist fließend, oft ab ca. 14-16 Jahren, je nach Eingriff und Reife) ist zusätzlich deren eigene Einwilligung erforderlich bzw. kann deren Wille entscheidend sein, auch wenn die Eltern zustimmen/ablehnen (sehr heikler Bereich!).
- Im Zweifel immer die Zustimmung aller Sorgeberechtigten einholen!
- Einwilligung bei nicht (mehr) einwilligungsfähigen Erwachsenen:
- Hier ist die Einwilligung eines bestellten gesetzlichen Betreuers (mit dem Aufgabenkreis “Gesundheitssorge”) oder eines Bevollmächtigten (mit entsprechender Vorsorgevollmacht) erforderlich.
- Liegt beides nicht vor und ist die Maßnahme dringend, muss ggf. eine Betreuung angeregt oder eine gerichtliche Genehmigung eingeholt werden (Notfälle ausgenommen).
Form und Dokumentation der Einwilligung:
- Die Einwilligung kann theoretisch mündlich, schriftlich oder durch schlüssiges Verhalten (konkludent – z.B. Patient öffnet den Mund zur Inspektion) erfolgen.
- Empfehlung: Für alle diagnostischen und therapeutischen Eingriffe, die über eine reine Inspektion hinausgehen, ist dringend eine explizite Einwilligung einzuholen und deren Erteilung in der Patientenakte zu dokumentieren. Bei größeren oder risikoreicheren Eingriffen ist die schriftliche Bestätigung auf dem Aufklärungsbogen der Goldstandard zur Beweissicherung.
Widerruf und Ablehnung:
- Der Patient kann eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen, auch noch während der Behandlung (sofern medizinisch möglich).
- Der Patient hat das Recht, eine empfohlene und aufgeklärte Behandlung abzulehnen (Patientenautonomie). Sie müssen diese Ablehnung respektieren.
- Wichtig: Dokumentieren Sie sowohl den Widerruf als auch die Ablehnung einer Behandlung sorgfältig in der Akte, inklusive der erneuten Aufklärung über die möglichen negativen Konsequenzen der Nicht-Behandlung!
Die Dokumentationspflicht (§ 630f BGB): Mehr als nur eine Gedächtnisstütze
Die Pflicht zur sorgfältigen und zeitnahen Dokumentation aller wesentlichen Maßnahmen und Umstände ist ein zentraler Bestandteil der zahnärztlichen Berufsausübung. Der alte Grundsatz “Was nicht dokumentiert ist, hat (im Streitfall) nicht stattgefunden!” hat nach wie vor Gültigkeit.
Zweck der Dokumentation:
- Therapeutische Zwecke: Gedächtnisstütze für Sie, Sicherstellung der Behandlungskontinuität (auch bei Vertretung oder Behandlerwechsel), Grundlage für zukünftige Behandlungsentscheidungen.
- Rechenschaftslegung: Nachweis der erbrachten Leistungen gegenüber dem Patienten und den Kostenträgern (Basis für die Abrechnung).
- Qualitätssicherung: Ermöglicht die Reflexion und Analyse des eigenen Handelns.
- Beweissicherung: Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Haftungsvorwürfen ist die Dokumentation das wichtigste Beweismittel. Eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation kann Sie entlasten, während eine mangelhafte oder fehlende Dokumentation im Prozess zu erheblichen Nachteilen bis hin zur Beweislastumkehr führen kann (d.h., es wird vermutet, dass eine nicht dokumentierte Maßnahme nicht erfolgt ist).
Inhalt der Dokumentation (Was gehört hinein?):
- Anamnese: Allgemeine und spezielle Anamnese, Risikofaktoren.
- Befunde: Alle erhobenen klinischen Befunde (Inspektion, Palpation, Perkussion etc.), Ergebnisse von Röntgenaufnahmen, Vitalitätsprüfungen, Modellen etc.
- Diagnose(n): Die gestellten Diagnosen müssen nachvollziehbar sein.
- Therapieplanung: Der vorgeschlagene Behandlungsplan und besprochene Alternativen.
- Aufklärung und Einwilligung: Dokumentation des Inhalts und Zeitpunkts des Aufklärungsgesprächs (stichpunktartig, z.B. “Aufklärung über Risiken XY, Alternativen Z, Kosten besprochen”) und die Bestätigung der Patienteneinwilligung (z.B. Vermerk “Patient willigt ein” oder Verweis auf unterschriebenen Aufklärungsbogen).
- Durchgeführte Maßnahmen: Für jede Sitzung: Datum, behandelter Zahn/Region, detaillierte Beschreibung des Vorgehens (z.B. “Trepanation, WK-Aufbereitung ISO 30, med. Einlage Ledermix, temp. Verschluss Cavit”), verwendete Materialien (insbesondere bei Füllungen, Kronen, Implantaten – ggf. mit Chargennummer bei bestimmten Produkten), verabreichte Anästhesie (Mittel, Menge).
- Besonderheiten & Komplikationen: Alle unerwarteten Ereignisse, Schwierigkeiten während der Behandlung oder aufgetretene Komplikationen müssen dokumentiert werden.
- Medikamentenverordnungen: Verordnete Medikamente mit Dosierung.
- Postoperative Instruktionen: Dem Patienten gegebene Verhaltenshinweise.
- Weitere Unterlagen: Eingehende Arztbriefe, Laborbefunde, pathohistologische Berichte etc. gehören ebenfalls zur Akte.
Form und Aufbewahrung:
- Zeitnah: Die Dokumentation sollte in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung erfolgen (§ 630f Abs. 1 BGB).
- Leserlich und verständlich: Auch für Kollegen oder Gutachter nachvollziehbar. Bei elektronischer Dokumentation auf klare Struktur achten.
- Vollständig: Alle wesentlichen Aspekte müssen enthalten sein.
- Änderungssicher: Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind zulässig, müssen aber klar als solche kenntlich gemacht werden (mit Datum, Uhrzeit, Kürzel des Bearbeiters). Der ursprüngliche Inhalt darf nicht unlesbar gemacht werden (§ 630f Abs. 1 Satz 3 BGB). Kein Tipp-Ex, kein Löschen ohne Nachvollziehbarkeit! Elektronische Systeme müssen revisionssicher sein.
- Aufbewahrungsfrist: Die gesetzliche Mindestaufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung (§ 630f Abs. 3 BGB). Längere Fristen können sich aus anderen Vorschriften oder zur Eigensicherung empfehlen.
Patienteneinsichtsrecht (§ 630g BGB):
- Der Patient hat das Recht, jederzeit und unverzüglich Einsicht in seine vollständigen Behandlungsunterlagen zu nehmen, sofern nicht erhebliche therapeutische Gründe oder Rechte Dritter entgegenstehen (sehr seltene Ausnahmen!).
- Er kann auch Kopien der Unterlagen verlangen, muss dafür aber die Kosten erstatten.
- Das Einsichtsrecht besteht auch für Erben bei vermutetem Behandlungsfehler oder zur Wahrnehmung anderer vermögensrechtlicher Interessen.
Die Schweigepflicht (§ 203 StGB, MBO, DSGVO): Absolutes Vertrauen schützen
Die ärztliche (und damit auch zahnärztliche) Schweigepflicht ist ein Eckpfeiler des Arzt-Patienten-Verhältnisses und eine Ihrer fundamentalsten Berufspflichten. Sie schützt die intime Privatsphäre des Patienten und ermöglicht erst das Vertrauen, das notwendig ist, damit Patienten auch sensible Gesundheitsinformationen und persönliche Umstände offenlegen.
Die rechtliche Verankerung – Mehr als nur eine Standesregel:
- Strafgesetzbuch (§ 203 StGB): Die “Verletzung von Privatgeheimnissen” durch Berufsgeheimnisträger (Ärzte, Zahnärzte, Anwälte etc.) ist eine Straftat. Ein unbefugtes Offenbaren kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden. Wichtig: § 203 StGB schützt auch die Geheimnisse, die Ihren berufsmäßig tätigen Gehilfen (also dem gesamten Praxisteam!) anvertraut oder bekannt geworden sind.
- Berufsordnungen (MBO-Z): Alle Landeszahnärztekammern haben die Schweigepflicht als zentrale Berufspflicht verankert. Verstöße können berufsrechtliche Maßnahmen (Rüge, Bußgeld, im Extremfall Entzug der Approbation) nach sich ziehen.
- Datenschutz (DSGVO/BDSG): Gesundheitsdaten gelten als “besondere Kategorien personenbezogener Daten” (§ 9 DSGVO) und genießen höchsten Schutz. Die DSGVO regelt primär die technischen und organisatorischen Aspekte des Datenschutzes (Speicherung, Verarbeitung, Sicherheit). Die Schweigepflicht nach § 203 StGB und MBO betrifft den inhaltlichen Schutz des anvertrauten Geheimnisses. Beide Regelwerke ergänzen sich und müssen beachtet werden.
Was genau ist geschützt? Der Umfang der Schweigepflicht:
- Umfassender Schutz: Geschützt ist grundsätzlich alles, was Ihnen in Ihrer beruflichen Eigenschaft als Zahnarzt/Zahnärztin über einen Patienten oder dessen Umfeld bekannt wird.
- Beispiele: Nicht nur medizinische Daten (Anamnese, Diagnosen, Röntgenbilder, Behandlungspläne), sondern auch persönliche, familiäre, berufliche oder finanzielle Verhältnisse, Gesprächsinhalte, Beobachtungen und sogar die bloße Tatsache, dass eine Person überhaupt Ihr Patient ist oder war.
- Form irrelevant: Die Pflicht gilt für mündliche Äußerungen, schriftliche Notizen, digitale Daten, Bilder etc.
- Geschützter Personenkreis: Primär der Patient selbst. Mittelbar können auch Geheimnisse Dritter geschützt sein, wenn diese im Rahmen der Behandlung des Patienten relevant werden (z.B. Informationen über ansteckende Krankheiten von Familienmitgliedern).
Wer muss schweigen? (Inklusive Team!)
- Sie selbst als Zahnärztin oder Zahnarzt.
- Ihr gesamtes Praxisteam: Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), Auszubildende, angestellte Zahnärzte, Zahntechniker im Praxislabor, Verwaltungskräfte, Reinigungspersonal – alle Personen, die berufsbedingt Zugang zu Patientengeheimnissen haben.
- Ihre Verantwortung als Praxisleitung: Sie müssen Ihr Team nachweislich über die Schweigepflicht belehren und zur Einhaltung verpflichten. Dies sollte bei Einstellung schriftlich erfolgen und ggf. regelmäßig aufgefrischt werden.
Wie lange gilt die Schweigepflicht?
- Die Schweigepflicht gilt zeitlich unbegrenzt, also lebenslang.
- Sie besteht auch über den Tod des Patienten hinaus (Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts und der Interessen der Angehörigen).
Wann darf oder muss die Schweigepflicht durchbrochen werden? (Ausnahmen – GENAU prüfen!)
Eine Offenbarung von Patientengeheimnissen ist nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig. Im Zweifel gilt: Schweigen ist die Regel!
- Einwilligung / Schweigepflichtsentbindung des Patienten:
- Dies ist die wichtigste und häufigste Rechtfertigung! Der Patient selbst stimmt der Weitergabe bestimmter Informationen an bestimmte Dritte (z.B. mitbehandelnder Arzt, Kieferorthopäde, Versicherung, Anwalt, Angehörige) für einen bestimmten Zweck zu.
- Anforderungen an die Einwilligung: Muss freiwillig, informiert (Patient weiß, was warum an wen weitergegeben wird) und unmissverständlich sein. Am besten schriftlich dokumentieren! Reichweite klar definieren (welche Infos, welcher Zeitraum, welcher Empfänger?). Die Einwilligung ist jederzeit durch den Patienten widerrufbar.
- Minderjährige/Betreute: Hier gelten die komplexen Regeln zur Einwilligungsfähigkeit (siehe Punkt C). Bei Minderjährigen ist oft die Einwilligung der Sorgeberechtigten nötig, bei betreuten Erwachsenen die des Betreuers (im Rahmen seines Aufgabenkreises).
- Mutmaßliche Einwilligung:
- Nur in akuten Notfallsituationen bei bewusstlosen oder anderweitig nicht einwilligungsfähigen Patienten denkbar, wenn die Informationsweitergabe (z.B. an Notarzt) dringend zur Abwendung einer Lebensgefahr oder schwerer Gesundheitsschäden erforderlich ist und man davon ausgehen kann, dass der Patient zustimmen würde, wenn er könnte. Sehr eng auszulegen!
- Gesetzliche Meldepflichten:
- Infektionsschutzgesetz (IfSG): Bei bestimmten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten besteht eine gesetzliche Pflicht zur Meldung an das Gesundheitsamt. Informieren Sie sich über die aktuell meldepflichtigen Krankheiten!
- Kindeswohlgefährdung (§ 4 KKG – Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz): Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung besteht ein Recht (und unter Umständen eine Pflicht) zur Information des Jugendamtes, ggf. nach vorheriger interner Beratung oder anonymisierter Fallvorstellung bei einer “insoweit erfahrenen Fachkraft”. Dies ist eine schwierige ethische und rechtliche Abwägung!
- Weitere spezifische Meldepflichten (z.B. nach Krebsregistergesetzen der Länder) können existieren.
- Gesetzliche Aussagegenehmigung / Zeugnispflicht vor Gericht:
- Als Zahnarzt haben Sie grundsätzlich ein Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich Ihrer Patientengeheimnisse (§ 53 StPO, § 383 ZPO).
- Sie dürfen nur aussagen, wenn der Patient Sie von der Schweigepflicht entbunden hat oder wenn eine gesetzliche Aussagepflicht besteht (sehr selten) bzw. eine richterliche Anordnung zur Durchbrechung ergeht (ebenfalls selten und an hohe Hürden geknüpft).
- Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB):
- Nur in absoluten Ausnahmefällen zur Abwendung einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder andere hochrangige Rechtsgüter Dritter (z.B. glaubhafte Ankündigung eines schwerwiegenden Gewaltdelikts). Die Schwelle liegt extrem hoch! Unbedingt vorher juristischen Rat einholen!
- Eigene Rechtsverteidigung:
- Wenn ein Patient Sie selbst verklagt (z.B. wegen eines Behandlungsfehlers), dürfen Sie zur notwendigen Verteidigung Ihrer Rechte die erforderlichen Patienteninformationen im Gerichtsverfahren offenlegen.
- Abrechnung:
- Die zur Abrechnung notwendigen Daten dürfen an die KZV (für BEMA) bzw. an private Abrechnungsstellen (sofern der Patient eingewilligt hat!) weitergegeben werden. Auch hier gilt das Gebot der Datenminimierung.
Praktische Konsequenzen im Alltag – Worauf achten? (Vertieft)
- Diskretion in der Praxis: Keine Patientennamen oder Details laut am Empfang oder Telefon nennen. Wartezimmergestaltung (Abstand). Besprechungen hinter geschlossenen Türen.
- Datensicherheit (Technisch & Organisatorisch): Sichere Passwörter, Bildschirmsperren, Virenschutz. Patientenakten (digital und Papier) sicher und zugriffsgeschützt aufbewahren. Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation mit Patienten (nur mit deren Einwilligung!). Nutzung von Cloud-Diensten nur, wenn DSGVO-konform (AV-Vertrag!). Sichere Gestaltung von Kontaktformularen auf der Website. Sichere Entsorgung von Patientenunterlagen (Aktenvernichter nach DIN 66399).
- Team-Management: Regelmäßige, nachweisliche Belehrung des gesamten Teams über Schweigepflicht und Datenschutz. Schriftliche Verpflichtungserklärungen bei Einstellung. Klare Anweisungen zum Umgang mit Informationen. Keine “Plaudereien” im Pausenraum oder privat!
- Soziale Medien / Privatleben: Absolutes Tabu! Keine Patientenfälle (auch nicht anonymisiert!), keine Fotos von Behandlungen (auch nicht mit vermeintlicher Einwilligung für Social Media – extrem heikel!), keine Kommentare über Patienten online oder im privaten Umfeld.
Folgen bei Verstößen:
- Strafrechtliche Verfolgung (§ 203 StGB).
- Berufsrechtliche Maßnahmen durch die LZK (bis zum Approbationsentzug).
- Zivilrechtliche Schadensersatzforderungen durch den Patienten.
- Hohe Bußgelder nach DSGVO durch die Datenschutzbehörden.
- Immenser und oft irreparabler Vertrauensverlust bei Patienten und in der Öffentlichkeit.
Fazit zur Schweigepflicht:
Die Schweigepflicht ist nicht verhandelbar und einer der wichtigsten Grundpfeiler Ihres Berufs. Ihre strikte Beachtung durch Sie und Ihr gesamtes Team ist unerlässlich. Im absoluten Zweifel gilt: Bewahren Sie Stillschweigen und holen Sie für jede geplante Weitergabe von Informationen die explizite, möglichst schriftliche Einwilligung Ihres Patienten ein.
Sorgfaltspflicht & Fachzahnarztstandard: Behandeln “lege artis”
Dies beschreibt die Kernpflicht Ihrer medizinischen Tätigkeit: die fachgerechte Behandlung.
- Maßstab (“Standard”): Sie müssen Ihre Behandlung nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, anerkannten fachlichen Standards durchführen. Dieser “Facharztstandard” (gilt auch für nicht-spezialisierte Zahnärzte im Rahmen ihrer Tätigkeit!) orientiert sich an den gesicherten Erkenntnissen der zahnmedizinischen Wissenschaft und der bewährten klinischen Erfahrung. Leitlinien (siehe Abschnitt 4.2) können hierbei eine wichtige Orientierung bieten, sind aber nicht alleiniger Maßstab.
- Wissen aktuell halten: Aus der Sorgfaltspflicht ergibt sich direkt die Pflicht zur kontinuierlichen Fortbildung (siehe Abschnitt 3.3), um den Anschluss an die wissenschaftliche Entwicklung nicht zu verlieren und stets nach aktuellem Standard behandeln zu können.
- Grenzen erkennen: Zur Sorgfalt gehört auch, die Grenzen des eigenen Wissens und Könnens zu erkennen und im Bedarfsfall rechtzeitig an entsprechend qualifizierte Kollegen (z.B. Fachzahnärzte) zu überweisen.
Gesamtfazit
Der Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Patienten ist mehr als nur eine Formsache – er begründet ein komplexes rechtliches Verhältnis mit weitreichenden Rechten und Pflichten für beide Seiten. Die sorgfältige Beachtung der Aufklärungspflicht, das Einholen einer informierten Einwilligung, die lückenlose Dokumentation, die strikte Wahrung der Schweigepflicht und die Behandlung nach aktuellem Fachzahnarztstandard (Sorgfaltspflicht) sind die unverzichtbaren rechtlichen Grundpfeiler Ihrer täglichen Arbeit. Sie dienen nicht nur dem Schutz und dem Wohl Ihrer Patienten, sondern sind gleichzeitig essenziell für Ihre eigene rechtliche Absicherung.